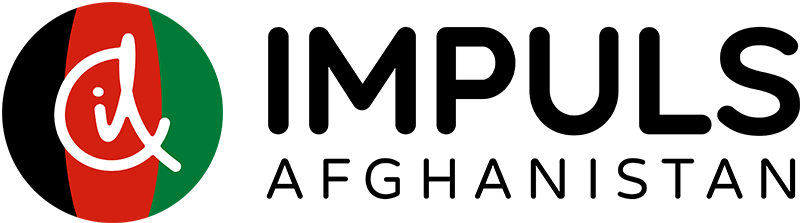Der Bürgerkrieg der Mujaheddin
Nach dem vollständigen Abzug der sowjetischen Truppen im Februar 1989 ging der Bürgerkrieg im Inneren des Landes jedoch unvermindert fort. Erst im April 1992 wurde Kabul von den Mujaheddin erobert und Präsident Nadschibullah gestürzt. Unter den Gruppen des ehemaligen afghanischen Widerstandes kam es jedoch im Anschluss zu heftigen Auseinandersetzungen untereinander.
Ende 1992 wurde Burhanuddin Rabbani von der tadschikischen Partei Jamiat-e-Islami zum Präsidenten gewählt. Seine Amtszeit sollte sich auf zwei Jahre beschränken. Der Paschtunenführer Gulbuddin Hekmatyar von der fundamentalistischen Organisation Hezb-e-Islami und andere kleinere Gruppen lehnten Präsident Rabbani jedoch ab. Durch eine terroristische Politik, ständigen Raketenbeschuss und schließlich die vollständige Blockade Kabuls im Winter 1992/93 erzwang Hekmatyar im Abkommen von Islamabad im März 1993 seine Ernennung zum Premierminister. Die Vereinten Nationen erkannten die am 17. Juni 1993 vereidigte, neue Regierung mit Hekmatyar als Premierminister an. Im September 1993 wurde eine Übergangsverfassung beschlossen, die bis zu den Neuwahlen Anfang 1994 bestehen sollte. Da eine erwartete Waffenruhe jedoch nicht eintrat und es im Januar 1994 erneut zu schweren Kämpfe kam, kündigte Rabbani die Regierungszusammenarbeit mit Hekmatyar auf. Die für März 1994 geplanten Wahlen fanden nicht statt. Um eine Entscheidung in der Machtfrage zu erreichen, schlug sich General Dostum, der Führer der usbekisch dominierten Dschonbesch-e Melli, der bisher den Präsidenten unterstützt hatte, auf die Seite seines früheren Feindes Hekmatyar. Doch dieser neuen Allianz gelang es trotz massiver Raketenangriffe auf Kabul nicht, Rabbani zu entmachten. Entgegen den Vereinbarungen trat dieser Ende Juni 1994 nicht von seinem Amt zurück, sondern baute mit Unterstützung der tadschikischen Miliz unter Ahmed Schah Massud seine Stellung in der Hauptstadt noch weiter aus.
Nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg ist die Hauptstadt Kabul nahezu völlig zerstört
Der Machtkampf unter den zerstrittenen Gruppen des ehemaligen Widerstandes hatte dazu geführt, das besonders die ländlichen Gebieten unter die Kontrolle einzelner Warlords und ihrer Milizen gelangt waren. Diese lokalen Machthaber finanzierten sich über Wegzölle, Steuern, Waffen- und Drogenhandel sowie den Schmuggel von Holz. Die Situation in Afghanistan war geprägt durch einen fortwährenden Zustand der Unsicherheit. Plünderungen, Vergewaltigungen und andere Gewalttaten standen auf der Tagesordnung.